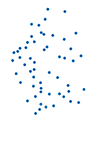aus dem Paracelsus Magazin: Ausgabe 2/1999
Religion und Spiritualität – Teil 1
“Es ist gut für den Menschen, seinen Kopf in den Wolken zu haben und seine Gedanken zwischen den Adlern wohnen zu lassen, aber er muß auch daran denken, daß, je höher der Baum in den Himmel hinein wächst, desto tiefer seine Wurzeln in das Herz der Mutter Erde hineindringen müssen.”
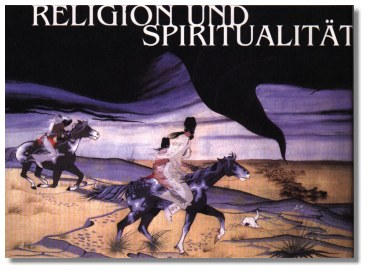 Teil 1
Teil 1
Autor: Klaus Bauer
Mutter Erde war fruchtbar und erneuerte sich ständig selbst im fortlaufenden Zyklus von Geburt, Aufwachsen, Reife, Tod und Neugeburt.
Die Indianerfrauen begriffen sich selbst als Bestandteil dieser immer wiederkehrenden Muster und akzeptierten eine Rolle, in der sie die irdische Ausprägung der spirituellen Muster und der Schlüssel zur Fortpflanzung ihrer Rasse waren. Beim Ritual der Geburt waren sie unter sich.
Es waren die Frauen, die die praktischen und zeremoniellen Dinge regelten und das Kind auf das Leben vorbereiteten. Frauenleben beeinflußte das, was als natürliche Ordnung des Universums begriffen wurde.
Die vorgeburtliche Gesundheitsvorsorge war geregelt durch Tabus. Bezüglich der Fortsetzung des Geschlechtslebens in der Schwangerschaft vertrat man die Auffassung, es nütze sowohl der Schwangeren wie dem Kind; die Frauen schliefen die gesamte Schwangerschaft hindurch weiter mit ihren Männern damit der fortgesetzte Verkehr das Kind wachsen lasse.
Eine Hopi-Frau verglich dies mit Begießen von Pflanzen:
Wenn ein Mann anfing, ein Kind zu machen, und dann mittendrin aufhörte bedeute dies für seine Frau, daß schwere Zeiten auf sie zukämen.
Bei den Wehen wurde die Indianerfrau von Frauen ihres Stammes unterstützt, die sich mit den Geburtsbräuchen auskannten.
Manche der Hebammen besaßen beachtliche Fähigkeiten; reichten ihre Macht und Fertigkeiten nicht aus, mußte ein Medizinmann herangezogen werden. Eine Indianerin hat berichtet, wie ihr ein solcher Medizinmann bei einer ihrer Schwangerschaften geholfen hat:
Der Mann war alt und blind, und er setzte sich zu der leidenden Frau. Als die Frau vor Schmerz schrie, berührte er sie mit dem Ende eines Stabes, und die Krämpfe ließen nach. Als die Frau klagte, sie sei müde, redeten die anderen ihr zu, es wäre alles bald vorüber, aber der Medizinmann war anderer Meinung. Die Wehen dauerten noch Stunden an, bis der Medizinmann sagte, das Kind werde nun geboren werden, und er hatte recht.
Man glaubte, die Macht des Medizinmannes ermögliche ihm zu wissen, was vor sich ging, ohne die gebärende Frau zu sehen oder zu berühren.
Indianerkinder wurden in eine Gesellschaft geboren, in der ausgeklügelte spirituelle Zeremonien das Stammesleben beherrschten.
Sobald das Kind geboren war, kam die Großmutter mütterlicherseits, um die Nabelschnur zu durchtrennen und abzubinden und ihre Tochter und das Enkelkind zu versorgen. Dann kam die Großmutter väterlicherseits und übernahm ihre Pflichten als Zeremonienmeisterin bei all den Ritualen, die während der zwanzigwöchigen Wochenbettpause zu vollziehen waren. Ihre erste Aufgabe bestand darin, eine schwere Decke vor den Eingang des Tipis zu hängen, damit kein Sonnenlicht in den Raum drang. Man nahm an, Licht schade Neugeborenen, und so begann das Baby sein Erdenleben in einem Raum, der fast so dunkel war wie der Mutterleib, dem es gerade entschlüpft war. Am 20. Tag wurde die Mutter rituell gereinigt. Ihr Haar und ihr Körper wurden mit einer Lösung gewaschen, die aus Wurzeln der Yucca-Pflanze gewonnen wurde, und dann nahm sie ein Dampfbad. Dann wurde das Kind von den Großmüttern und Tanten mit der Yucca-Lösung gewaschen und ihm ein Name gegeben.
Während all dies vonstatten ging, erwartete der Vater auf einem Felsen den Sonnenaufgang. Sobald der “geheiligte Vater Sonne” erschien, wurde das Kind von den Frauen an den Rand der Bergebene getragen, hochgehoben und der Sonne zugedreht. Dabei wurde ein Gebet an die Mächte der Himmel, der Luft und der Erde gesprochen, das Kind wurde darin als das Wesen genannt, das im Begriff stand, den rauhen Weg des Lebens zu gehen, der sich über vier Hügel erstreckte, die die vier Lebensalter der Kindheit, der Jugend, der Erwachsenenjahre und des Alters bezeichnet.
 Sobald das Kind auf eigenen Füßen stehen konnte, ließ man ihm sehr viel Freiheit. Schläge gab es nicht. Man scheute sich sogar davor, seine Abkömmlinge zu schelten. Die älteren Familienmitglieder praktizierten eine zwanglose Unterweisung der Heranwachsenden in allen Fragen, die für das Leben von Bedeutung waren.
Sobald das Kind auf eigenen Füßen stehen konnte, ließ man ihm sehr viel Freiheit. Schläge gab es nicht. Man scheute sich sogar davor, seine Abkömmlinge zu schelten. Die älteren Familienmitglieder praktizierten eine zwanglose Unterweisung der Heranwachsenden in allen Fragen, die für das Leben von Bedeutung waren.
Ein junger Mann galt nach dem Erlegen des ersten Bären als erwachsen. Man sollte sich aber davor hüten, dies als reine Mutprobe anzusehen. Der Indianer sah im Tier ein gleichwertiges Wesen, er sprach von ihm als Bruder Tier.
Nach dem Eintritt der Reife waren die jugendlichen Verwandten unterschiedlichen Geschlechts gezwungen, sich zu meiden. Bei einigen Stämmen herrschte der Brauch, jedes Mädchen bei der ersten Menstruation vier Tage abzusondern. Die Furcht vor Menstruationsblut und die Vorstellung, daß dieses heilige Objekte zu beschmutzen vermochte, waren weit verbreitet.
Wenn das Interesse für das andere Geschlecht erwachte, machte der Jüngling seiner Auserwählten beim Brennholzsammeln oder Wasserholen den Hof. Hatte er sich entschlossen, das Mädchen zu heiraten, trug er diesen Wunsch seinen Familienangehörigen vor.
Waren Mutter und Schwestern mit dem Vorhaben einverstanden, begab sich eine Frau aus ihrer Mitte zu der Familie der Geliebten, um das Anliegen zu besprechen.
Die Entscheidung über den Antrag lag aber bei ihrem Vater oder Bruder. Willigte der ein, gaben die Brauteltern ein Fest, auf dem die Ehe ohne weitere Förmlichkeiten geschlossen wurde. Der Bräutigam war verpflichtet, seinem Schwiegervater Pferde zu schenken. War er arm, konnte er den Preis für seine Frau abarbeiten. Und stellte sich heraus, daß die Jungvermählten nicht zueinander paßten, stand einer Trennung nichts im Wege.
Fast alle Stämme hatten ein ausgeprägtes Bundwesen. Die Knaben kamen mit etwa zehn Jahren in den Bund der törichten Hunde. Die Väter mußten ihre Söhne in die Gesellschaft einkaufen, d.h. sie tauschten ein Pferd gegen das dem Bund zugehörende Lied, den Tanz und die Knochenflöte. Diese Dinge blieben Eigentum des Jungen, bis er sie später an einen Jungen weitergab und sich in die nächste Gesellschaft einkaufte. Das war die Krähenbande, der man vom zwanzigsten bis zum fünfundzwanzigsten Lebensjahr angehörte. Dann folgte der Kriegerbund. Die vierte Gesellschaft war der Hundebund; seine Mitglieder übten eine Art Polizeifunktion innerhalb des Stammes aus.
Im Bund der Bison waren nur ganz außergewöhnliche Männer vereint. Die Männer über fünfzig waren in der Gesellschaft der schwarzschwänzigen Hirsche zusammengefaßt. Alle diese Bünde besaßen gesellschaftlichen Charakter oder hatten bestimmte soziale Funktionen zu erfüllen.
Die Geheimbünde hingegen waren religiöse Bünde, zu denen der Beitritt nur einem beschränkten Kreis möglich war. Man erwartete von den Mitgliedern ganz besondere Fähigkeiten, die im Bereich des Magisch-Visuellen und der Krankenheilung lagen.
Die oberste Institution bildeten die Medizinmänner. Allerdings darf die indianische Medizin niemals mit einem Heilmittel identifiziert werden. Medizin bedeutete magische Kraft, wenngleich ein Medizinmann auch als Arzt fungierte.
Alte Menschen waren ein schweres Problem für die Bisonjäger denn das Leben war hart. Wer zu gebrechlich war, ein Pferd zu besteigen oder sich auf einem Schleppgerüst zu halten, wurde zurückgelassen. Oft erfuhr ein alter Mensch, der sich dem harten Leben nicht mehr gewachsen fühlte und sich dadurch als Last für seine Familie empfand, im Traum eine Aufforderung zur Beendigung seines Lebens.
Hatte er die Kraft, verschwand er eines Nachts und suchte in der Einsamkeit den Tod. Reichten seine Kräfte dafür nicht mehr aus, bat er seinen Sohn oder seine nächsten Verwandten, ihn zu töten. Die Kinder hielten es für ihre Pflicht, die Bitte der Alten zu erfüllen.


Die verbreitetste Form der Totenbestattung war die Gerüstbestattung und spätere Zweitbestattung, also die Beisetzung der Knochen.
In waldreichen Landschaften konnte das Baumgrab, eine Plattform auf starken Ästen, das Totengerüst ersetzen. Der Tote bekam seine vorläufige Ruhestätte in einer Umhüllung aus Fell. Die Totengerüste standen in der Nähe der Dörfer, weil man mit seinen Toten Kontakt behalten wollte und sie oft zur stillen Zwiesprache besuchte.
Nachdem die Gerüste zusammengebrochen waren, wurden die Skelette in einem Grab unter einem Erdhügel beerdigt. Nur den Schädel behielt man zurück. Er bekam seinen Platz in einem Kreis von Schädeln, die in einem Rund von etwa zehn Metern Durchmesser um einen kleinen Erdhaufen mit je einem männlichen und weiblichen Bisonschädel lagen. Ein hoher Medizinpfahl schützte die heilige Stätte.
Die Mehrzahl der Indianer hat an zwei Seelen geglaubt, nämlich an Nagi und Niya.
Nagi war die Frei-Seele, jener Hauch, der von den Oglala aufbewahrt und dann auf den Geisterpfad (Milky Way, Milchstraße) geschickt wurde.
Niya war die Lebensseele, die an den menschlichen Körper gefesselt war und die Tätigkeit der Organe regulierte.
Die Shoshone pflegten auf die Frage, was denn nach dem Tode übrig bliebe, zu antworten: das Individuum. Daraus ergibt sich, daß die Seele (oder eine der Seelen) nicht immer mit der zukünftigen Existenz verknüpft war.
In der Regel nahm man jedoch an, daß die mit der Traumseele zu identifizierende Freiseele in das Reich der Toten reiste, während die Lebensseele nicht abzusterben brauchte. Sie konnte als Gespenst umherirren, meist in der Nähe des Begräbnisplatzes.
Die Freiseele, die auf dem Geisterpfad vor Hihankara, der alten Frau “Eulenmacher”, keine Gnade gefunden hatte, wurde zurückgestoßen und mußte für immer auf der Erde umherirren.
Das Totenreich war ein mit den Attributen eines glückseligen Diesseits ausgestattetes Jenseits. Kein Indianer hat an Dinge geglaubt, unter denen er sich nichts vorstellen konnte.
Das Paradies lag fern im Westen hinter der Stelle, wo die Sonne am Abend verschwand. Es war ein Tal von großer Weite, und alles dort war perfekt geordnet. Es gab weder Wind noch Regen, das Klima war mild, es dunkelte nicht, weil der “Große Geist” alles mit Licht erfüllte, es gab Bisons, Wapitis, Hirsche und Antilopen, und es gab keinen Hunger, keine Gefahren und keine Krankheiten.
Was die indianische Religiosität von unserer unterscheidet, ist die andersartige Einstellung zu ihrer Umwelt.
Das Distanzgefühl, das uns bei der Betrachtung der außermenschlichen Sphäre beherrscht, war den Indianern völlig fremd. Sie glaubten an eine enge Verbundenheit mit den Tieren und Pflanzen, und für sie hatte jede Kreatur, jedes Gewächs und jeder leblose Gegenstand seinen festen Platz und seine Funktion in der kosmischen Ordnung.
Es war, wie Häuptling Seattle dem Großen Weißen Vater in Washington erklärte.
Die duftenden Blumen sind unsere Schwestern. Der Hirsch,
das Pferd, der große Adler: sie alle sind unsere Brüder. Alle
Dinge sind miteinander verbunden wie das Blut, das eine Familie vereint”

Diese von unserer Sinnesart abweichende Geisteshaltung erstreckte sich auch auf das Göttliche, das nach der Vorstellung der Indianer in der gesamten Schöpfung anwesend war.
Manitu, Wakan-Tanka, der Große Geist war keine frei im Raum schwebende Zaubermacht. Manitu war eine Eigenschaft. Manitu wurde nie mit einer impersonellen, supra-naturalistischen Potenz identifiziert. Der Terminus manitu wurde adjektivisch im Sinne von heilig, seltsam, bemerkenswert, wunderbar, ungewöhnlich und machtvoll gebraucht.
Außerhalb der Erscheinungswelt gab es kein manitu; manitu war dem gesamten außermenschlichen Bereich als Naturgegebenheit eigen. Das bedeutet, daß alle Berge, alle Steine, alle Pflanzen und alle Tiere von Haus aus manitu besaßen. Nur der Mensch hatte nach dem Erwerb dieser Eigenschaft zu streben.
Die Sehnsucht der Indianer nach Visionen hing eng mit dem Begehren nach manitu zusammen. Begriffe wie übersinnlich und übernatürlich waren dem Indianer fremd.
Er hielt sich einzig und allein an das Faktum der Verschiedenheit zwischen seiner eigenen Person und den Konkreta der Natur. Für ihn existierte nichts außerhalb der Realität. Auch das Totenreich war für ihn eine perzeptive Gegebenheit. Die Basis des “großen Geheimnisvollen” war die Gesamtheit der Erscheinungswelt, d.h. die Welt selbst.
Wakan Tanka ist die Formel der kosmischen Gottheit. Sie setzt sich aus 16 wohlwollenden Wakan-Wesen und den übelwollenden Wakan-Gestalten zusammen. Alle zusammen bildeten eine Einheit, nämlich Wakan Tanka.
Die guten Wakan ordneten sich nach der heiligen Zahl Vier. Zu den präsidierenden Mächten zählten erstens Wi, die Sonne, zweitens der Große Geist, Skan, wobei das Blau des Luftmeeres seine ständige Anwesenheit anzeigte, drittens die Erde und Allmutter Maka und viertens Inyan, der Felsen und Allvater. Mit diesen vier Potentaten waren Hanwi, der Mond, Tate, der Wind, Wohpe, das Weib und Wakinyan, der Geflügelte verbündet.
Unter diesen acht Potenzen standen Tatanke, der Bisongott, Hunonpa, der Bärengott, Tatetob, die Vier Winde und Yumni, der Wirbelwind. Dazu kamen die Wakangleichen, nämlich Nagi, die Freiseele, Niya, die Lebensseele respektive der Totengeist, Nagiya, das Seelengleiche und Sicun, die übernatürliche Kraft.
Zu den übelwollenden Wakan gehörten die Unktehi, große Bisons, die sich fortwährend mit den Donnervögeln stritten. Die männlichen Unktehi lebten unter Wasserfällen und in den Tiefen der Seen, die weiblichen in der Erde. Zu den bösartigen Wakan gehörten außerdem der Täuscher Iktomi, der menschenfressende lya, der gefährliche Bisonbulle Gnaski, der in der Behausung des Nordwindes lebende Zauberer Waziya, seine als Hexe verschrieene Frau Wakanka und deren doppelgesichtige, die Schwangeren folternde Tochter Anog Ite.
 Der nicht von einem Medizinmann ausgebildete Indianer hat sich das Gefüge des Universums sicher einfacher vorgestellt.
Der nicht von einem Medizinmann ausgebildete Indianer hat sich das Gefüge des Universums sicher einfacher vorgestellt.
Er kannte die Macht der Sonne und des Himmelsgottes. Er wußte über die donnernden wakinyan und die Heimtücke der bösen Wakan Bescheid. Ihm waren die Kardinalpunkte vertraut, an denen die Vier Winde wohnten. Er sah sein Tipi und die Schwitzhütte als Abbilder des Weltgebäudes an. Er glaubte an die Heiligkeit der Erde, der Pfeife und des Reifens.
Und er verstand zumindest das äußere Geschehen der großen Stammesfeiern, denn der Geist spricht:
“Ich bin es, der im Sturm daherkommt
Ich bin es, der im sanften Winde flüstert
Ich schüttele den Baum
Ich erschüttere die Erde
Ich bewege die Wasser in alle Richtungen”
Großer Respekt wurde der Erde entgegen gebracht. Man bezeichnete sie als “Mutter”. Sie bildete den Fußboden des Weltgebäudes und personifizierte die weibliche Seele des Kosmos.
Da die Erde alles barg, was Mensch und Tier zum Leben benötigten, wurde sie unmittelbar nach der Sonne angerufen. Denn:
“Das Leben des Menschen ist angewiesen auf die Erde
Das Große Geheimnis wirkt durch sie
Das Samenkorn wird in die Mutter Erde gelegt
Und sie bringt die Maispflanze hervor
Gerade so, wie Kinder gezeugt
Und von Frauen geboren werden”
Auch der Bison war mit der Erde verkoppelt, so daß die Trinität Erde-Bison-Frau der Dreiheit Himmel-Adler-Mann gegenüberstand.
Die enge Verbundenheit zwischen weiblichen Komponenten des Alls wird auf den Bisonroben der Indianerinnen sichtbar. Diese Fellmäntel trugen eine rechteckige Zeichnung, die von einem Rahmen umschlossen wurde, der ein Bisonfell darstellen sollte. Weil Bison und Erde in der Vorstellungswelt der Indianer ineinanderfließen, ist dieses Muster ein Erdsymbol.
Das Umane, ein Signum der Erde und der Vier Winde, das bei jeder bedeutenden Zeremonie in den Boden gestochen wurde, ist quadratisch; seine vier Ecken laufen in langen Spitzen aus; die vier Spitzen symbolisieren die Heimat der Vier Winde.
Unter den großen Verehrungswürdigen Sonne, Himmel, Donner, Wind, Mond, Morgenstern, Erde und Felsen standen zahlreiche niedere Wesen, die teils als bösartig, teils als gutartig galten.
Außerdem gab es Gnome von gewaltiger Kraft, Kobolde, die in den unwegsamen Bergen lebten, und Wassergeister, die gehörnt, haarig und Bullengestaltig in Quellen hausten und zuweilen Menschen ins Gewässer zogen und verschluckten.
Die indianische Lebensweise hatte ihre Basis in der Religion.
Für Indianer bestand die Welt nicht aus irdischen und religiösen Teilstücken, sondern sie war ein unteilbar Ganzes, eine Einheit.
Indianer waren überzeugt, daß spirituelle Kräfte allgegenwärtig sind. Religion berührte alle Dinge. Sie war eine Lebensform, eine Art zu leben, nicht eine Sammlung von Glaubensvorschriften.
Religion durchdrang das tägliche Leben. Man sonderte nicht einen Teil der Woche ab für die Beziehungen zu Gott.
Wie Häuptling Seattle erklärte:
“Eure Religion wurde auf Steintafeln geschrieben von dem ehernen Finger eines
erzürnten Gottes, damit ihr sie nicht vergessen würdet.
Wir konnten das nie begreifen und auch nicht behalten.
Unsere Religion besteht in der Tradition unserer Verfahren – in den
Träumen unserer alten Männer, die ihnen in den stillen Stunden der Nacht vom Großen Geist
gegeben werden – und in den Visionen unserer Weisen. Und sie steht geschrieben
in den Herzen unseres Volkes.”
Es war indianische Überzeugung, daß Intensität des Willens, konzentriertes Bewußtsein, starkes Wünschen und das Gefühl von Kraft, Freude, Glück, Schönheit und Vereinigung mit den Quellen des Universums einen direkten Einfluß auf die Welt und ihre Dinge und Vorgänge hatten.
Jeder kosmische Prozeß ist nicht nur mechanischer, sondern auch seelisch-spiritueller Natur und deshalb für solche Kräfte und Einflüsse offen.
Deshalb bedeutete für die Indianer “Medizin” mehr als eine Substanz, die einem kranken Körper Gesundheit zurückgibt.
“Medizin” bedeutet Energie, eine der Natur innewohnende Lebenskraft. Die “Medizin” einer Person war ihre Macht und Kraft, der Ausdruck ihres eigenen Lebensenergiesystems.
Wird fortgesetzt
zurück zur Übersicht dieser Ausgabe