Das in der Einsamkeit durch Traumfasten empfangene “Gesicht” war von größter
Bedeutung.
Derartige Offenbarungen machten den Indianer mit einem Schutzgeist bekannt. Mit seiner
Hilfe hoffte er zu erlangen, wonach er trachtete: Gesundheit, Unverwundbarkeit, Familienglück, Reichtum, Erfolg im
Kampf, Häuptlingswürde und damit Ansehen bei Freund und Feind.
Angesichts der großen Zahl von Geistern und Mächten,
mit denen der Indianer zu tun hatte, hielten die meisten Stämme es für angebracht, daß sich jeder einzelne einen
persönlichen Schutzgeist als Fürsprecher und Vermittler suchte. Dieser erschien ihnen in einer durch Fasten
herbeigeführten Vision.
 Der erzwungene Traum stellte für den Indianer
die wichtigste Verbindung mit den Mächten der außermenschlichen Sphäre dar. Den ungewollt kommenden Alltagsträumen
wurde dagegen wenig oder gar kein Wert beigemessen. Die von den Indianern entwickelte Traumtechnik gipfelte in der
Ausschaltung des Bewußtseins, denn nur in der Entrückung konnte sich das ersehnte Phänomen einstellen. Schon in der
Kindheit, spätestens im Pubertätsalter bemühten sie sich um eine Offenbarung. Ein Jüngling, der eine
Vision anstrebte, erklomm einen einsamen Gipfel, um dort zu fasten, zu dürsten und die höheren Mächte um Mitleid zu
bitten. Er trug nur einen Lendenschurz, und nachts wickelte er sich in ein Bisonfell. Wenn die Sonne in seiner
Abgeschiedenheit das erste Mal über den Horizont kroch, hackte er ein Glied seines linken Zeigefingers ab, legte es
auf einen Haufen Bisonkot, streckte es der Sonne entgegen und betete:
Der erzwungene Traum stellte für den Indianer
die wichtigste Verbindung mit den Mächten der außermenschlichen Sphäre dar. Den ungewollt kommenden Alltagsträumen
wurde dagegen wenig oder gar kein Wert beigemessen. Die von den Indianern entwickelte Traumtechnik gipfelte in der
Ausschaltung des Bewußtseins, denn nur in der Entrückung konnte sich das ersehnte Phänomen einstellen. Schon in der
Kindheit, spätestens im Pubertätsalter bemühten sie sich um eine Offenbarung. Ein Jüngling, der eine
Vision anstrebte, erklomm einen einsamen Gipfel, um dort zu fasten, zu dürsten und die höheren Mächte um Mitleid zu
bitten. Er trug nur einen Lendenschurz, und nachts wickelte er sich in ein Bisonfell. Wenn die Sonne in seiner
Abgeschiedenheit das erste Mal über den Horizont kroch, hackte er ein Glied seines linken Zeigefingers ab, legte es
auf einen Haufen Bisonkot, streckte es der Sonne entgegen und betete:
“Du siehst mich, ich bin bemitleidenswert.
Hier ist ein Stück meines Körpers, ich gebe es dir, iß es
auf!
Gib mir dafür etwas Gutes. Schenke mir ein langes Leben.
Laß mich ohne Mühsal Glück erringen!”
Bei dieser Rede blutete die Wunde, er brach zusammen, und obwohl sein Körper durch den Blutverlust bereits stark geschwächt war, empfing er sein “Gesicht” meist nicht vor der vierten Nacht. Das “Ergebnis der vierten Nacht” gehört zu den Eigentümlichkeiten des Traumfastens.
Vier und Sieben waren heilige Zahlen: Die Vier bezog sich auf die Kardinalpunkte, die Sieben
markierte zusätzlich den Himmel, die Erde und die Mitte des Universums.
Aber nicht alle haben sich ein Fingerglied
abgeschlagen. Andererseits ist die Entkräftung manchmal durch wesentlich härtere Torturen intensiviert worden.
Wenn
ein Kandidat vom Glück begünstigt war, konnte er während des Traumfastens ein Geräusch hören, z.B. den Schrei eines
Adlers oder das Heulen eines Kojoten, dann war dieses Tier seine Medizin. Er konnte aber auch eine Anweisung erhalten,
z.B.:
“Nimm morgen früh ein Bad im Bach da unten. Dann gehe in Richtung Osten, bis du einen einjährigen Bison
durch eine Schlucht kommen siehst.”
Der Kandidat befolgte die Order, traf das erwähnte Wild und eignete
fortan die Medizin dieses Tieres. Außer dem Bison konnten z.B. Bär, Wapiti, Puma, Otter, Pferd, Kaninchen, Hund,
Adler, Habicht, Sperber, Krähe, Schlange, Wolf, Biber usw. als Wächter und Glücksbringer fungieren.
 Jedes Traumerlebnis war mit einer Unterweisung des
Visionärs verbunden. So konnte ihm befohlen werden, bestimmte Nahrungsmittel zu meiden, sich auf eine
besondere Art zu kleiden, zu schmücken, zu bemalen und zu verhalten. Außerdem zeigte ihm der Geist Gegenstände, die er
anfertigen und in Zukunft bei sich tragen mußte. Diese Objekte waren dann die persönliche Medizin des Mannes. Um den
Schutzgeist jederzeit anrufen zu können, empfing er zudem einen Gesang oder mehrere Lieder.
Jedes Traumerlebnis war mit einer Unterweisung des
Visionärs verbunden. So konnte ihm befohlen werden, bestimmte Nahrungsmittel zu meiden, sich auf eine
besondere Art zu kleiden, zu schmücken, zu bemalen und zu verhalten. Außerdem zeigte ihm der Geist Gegenstände, die er
anfertigen und in Zukunft bei sich tragen mußte. Diese Objekte waren dann die persönliche Medizin des Mannes. Um den
Schutzgeist jederzeit anrufen zu können, empfing er zudem einen Gesang oder mehrere Lieder.
Wurden die
Anordnungen des Schutzgeistes hernach öfters verletzt, konnte dieser die Hand von
seinem Schützling abziehen. Auf der anderen Seite konnte auch der Schützling das Verhältnis wieder lösen. Hatte ein
Indianer die Absicht, ein solches Band zu zerreißen, ging er zu dem Platz, an dem ihm das Gesicht erschienen war,
dankte dem Schutzgeist für seine Fürsorge und warf die Sachen fort, die ihn an seinen Patron erinnerten. Viele aber
bekamen trotz aller Bemühungen keine Offenbarung. Sie konnten Macht von erfolgreichen Visionären erwerben, denn eine
Potenz konnte auch übertragen werden.
Für die Indianer war das Traumfasten, die Visionssuche ein Exerzitium, das
ihr ganzes Leben überspannte. Die Übung wurde wiederholt, wenn man den Kriegspfad betreten oder einen
Schild herstellen wollte, wenn man alles verloren hatte, wenn man Hunger litt, wenn ein Kind gestorben oder ein
Familienmitglied erkrankt war. Die oftmalige Herbeiführung einer Trance, das häufige Erlangen von
Traumsignalen machen verständlich, daß eine Person von mehreren Schutzgeistern adoptiert werden
konnte. In solchen Fällen verlieh jeder Schutzgeist dem Schützling seine spezifischen Kräfte.
Heilig war außer den angeführten Objekten, Mustern und Elementen vor allem der Kreis, in dem sich die Kraft des Kosmos auswirkte. Diese Form zeigte sich in der Basis des Zeltes, dem Reifen, den die Oglala bei Beschwörungen benutzten, dem Rund der Trommel, dem mit einem Netzwerk versehenen Ring für das Reifenspiel und im Rand des Pfeifenkopfes, der den Indianer an den erdumfassenden Horizont erinnerte.
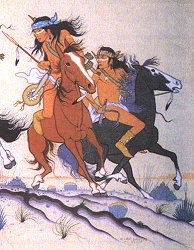 Das Pfeifenrohr repräsentierte alle Pflanzen
Das Pfeifenrohr repräsentierte alle Pflanzen
Tierzeichen darauf
repräsentierten alle Tiere
Angebundene Federn repräsentierten alle Vögel
Die Tabakteilchen repräsentierten
die vielen Geschöpfe Gottes
So wurden durch das Rauchen der Pfeife der ganze Kosmos und alle Schöpfung
zusammengeführt
Denn heilig war auch das Feuer, und wenn der Tabak in der Pfeife glühte, gemahnte er die Indianer
stets an Wakan Tanka, ihre höchste Macht:
“Und der Rauch stieg langsam, langsam
Durch die stillen
Morgenlüfte…
Immer höher, höher, höher,
Bis er traf des Himmels Wölbung…”
Heilig waren auch die Farben Rot und Blau. Rot vertrat die Erde; Blau stellte den Himmel dar. Rot war auch der heilige Pfad, der von Norden nach Süden verlief. Schwarz war dagegen der Pfad des Bösen, der Ost und West miteinander verband.
Die Zeremonien der Indianer fanden in einem Ritualzelt oder unter freiem Himmel statt. So auch der Geistertanz.
Einmal wurde eine Frau, die seit langen unheilbar krank war, zu einer Geistertanz-Versammlung gebracht und die
Trommler übten ihr Geisterlied. Das versetzte sie in die Lage, sich von ihrem Krankenlager zu erheben und ihren
Geistertanz vorzuführen.
Als später jemand nachfragte, ob bei diesem Ereignis auch alles mit
rechten Dingen zugegangen sei, sang sie ein Lied über ein schneebedecktes Kanu. Am nächsten Morgen waren die
Dorfbewohner beim Erwachen überrascht, ihr Dorf verschneit vorzufinden. Nun baten die Ungläubigen sie, den Schnee
verschwinden zu lassen. Die Frau bemalte ihr Gesicht, watete durch den Schnee, kam schweigend wieder zurück, ging heim
in ihr Tipi und sagte: “Meheu – es ist getan”. Darauf begann ein warmer Regen niederzugehen, der den Schnee vor
Tagesanbruch vollständig wegschmolz.
Vielleicht war es die Intensität des Willens, das konzentrierte Bewußtsein, dieses “Das Ganze der Natur ist in mir, und ein bißchen von mir ist im Ganzen der Natur”, das dies ermöglichte.
 Nachvollziehbar wird das innere Drama, das unter der Oberfläche
nüchterner ethnologischer Dokumentation eines Geistertanzes liegt, durch Frank Waters, der an einem
Hirschtanz teilgenommen hat: Dabei kommen die beiden Hirschmütter, einen Raum zwischen ihnen, auf und
nieder, von beiden Seiten. Gesetzte, ernste Frauen mittleren Alters mit langer Erfahrung, die besten Tänzerinnen im
Stamm. Selbstsicher und langsam, wie Frauen tanzen, kommen sie daher getanzt. Hochgewachsen, undurchdringlich,
schweigend kommen sie tanzend daher. Ihre weißen Mokassins heben sich nie über den Schnee, ihre kräftigen Körper
bewegen sich rhythmisch in den lockeren, fließenden Hirschledergewändern. Am Wendepunkt halten sie inne, schwenken
ihre Kürbisrasseln, heben ihre Adlerfedern mit leidenschaftslosem Gesicht. Alle machen den Hirschmüttern Platz: die
Büffel und die Antilopen, die Kojoten und die fauchenden Wildkatzen. Sie alle weichen zurück und kauern sich nieder
vor der geheiligten, unverletzlichen Hirschmutter. Dann wenden sich die Hirschmütter um, die Blicke gesenkt, als seien
sie sich der Anwesenheit der anderen gar nicht bewußt. Und geführt von den Hirschhäuptlingen folgen ihnen alle Reihen
der Tänzer in großen Kreisen und Spiralen. Folgen ihnen, tanzen im weichen, pulvrigen Schnee, stoßen ihre seltsamen,
leisen Unmutsschreie, ihr trotziges Knurren aus. Aber sie können nicht widerstehen und werden wieder zurück in das
lange Oval geführt. Dort schlägt unablässig die Trommel; es ist der Pulsschlag der Ewigkeit, der den Takt hält zum
wechselnden Fluß der zweipoligen Spannungen des Lebens.
Nachvollziehbar wird das innere Drama, das unter der Oberfläche
nüchterner ethnologischer Dokumentation eines Geistertanzes liegt, durch Frank Waters, der an einem
Hirschtanz teilgenommen hat: Dabei kommen die beiden Hirschmütter, einen Raum zwischen ihnen, auf und
nieder, von beiden Seiten. Gesetzte, ernste Frauen mittleren Alters mit langer Erfahrung, die besten Tänzerinnen im
Stamm. Selbstsicher und langsam, wie Frauen tanzen, kommen sie daher getanzt. Hochgewachsen, undurchdringlich,
schweigend kommen sie tanzend daher. Ihre weißen Mokassins heben sich nie über den Schnee, ihre kräftigen Körper
bewegen sich rhythmisch in den lockeren, fließenden Hirschledergewändern. Am Wendepunkt halten sie inne, schwenken
ihre Kürbisrasseln, heben ihre Adlerfedern mit leidenschaftslosem Gesicht. Alle machen den Hirschmüttern Platz: die
Büffel und die Antilopen, die Kojoten und die fauchenden Wildkatzen. Sie alle weichen zurück und kauern sich nieder
vor der geheiligten, unverletzlichen Hirschmutter. Dann wenden sich die Hirschmütter um, die Blicke gesenkt, als seien
sie sich der Anwesenheit der anderen gar nicht bewußt. Und geführt von den Hirschhäuptlingen folgen ihnen alle Reihen
der Tänzer in großen Kreisen und Spiralen. Folgen ihnen, tanzen im weichen, pulvrigen Schnee, stoßen ihre seltsamen,
leisen Unmutsschreie, ihr trotziges Knurren aus. Aber sie können nicht widerstehen und werden wieder zurück in das
lange Oval geführt. Dort schlägt unablässig die Trommel; es ist der Pulsschlag der Ewigkeit, der den Takt hält zum
wechselnden Fluß der zweipoligen Spannungen des Lebens.
So geht es weiter auf der verschneiten, festgetrampelten
Lichtung zwischen den Felsen: das uralte Drama der uranfänglichen Kräfte, die in all ihren Kindern freigesetzt werden.
Das hüpfende, rasche Entschlüpfen, das von den Hirschwächtern vereitelt wird. Und unentwegt werfen die
Hirschhäuptlinge neben dem Trommler ihre Geweihe hoch, während, auf und nieder, die heiligen Hirschmütter sanft vor
den in Gefangenschaft gehaltenen Tieren tanzen. Sie weichen vor ihnen zurück, versuchen, aus dem magischen Zirkel
auszubrechen, werden zurückgerissen, wie das Bewußtsein in seinem wilden Verlangen nach Befreiung vom Intellekt immer
vom ewigen Unbewußten zurückgezerrt wird. Und die ganze Zeit stoßen sie ihre leisen Schreie aus, den tiefen,
männlichen Schrecken über ihre Unterwerfung. Aus ihnen heraus quillt es in schaudernden Seufzern des Widerwillens und
der Verzweiflung, während sie doch auf den Ruf antworten. Auf allen Vieren, als die ungezähmten, archaischen, wilden
Kräfte, die sie darstellen, gezwungen, ihnen zu folgen im Gehorsam gegenüber jener kosmischen Dualität, die es geben
muß, um selbst noch ihren spirituellen Unwillen zu bewahren…
Man spürt hier zugleich etwas von der Kraft, die uns zurückhält, und der Kraft, die uns vorantreibt auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Die uns in ihrer zweipoligen Spannung im Gleichgewicht halten, eingebettet in den warmen Fluß des menschlichen Lebens. Denn in all seinem mächtigen Streben nach Freiheit ist der Mensch an den entgegengesetzten Pol seines erdgebundenen Daseins gefesselt, bis auf einer höheren Stufe des Bewußtseins diese Gegensätze wieder vereinigt werden wie am Anfang.
HEILWEISEN DER INDIANER
 Die Indianer haben sich immer als Teil der Natur betrachtet:
Erde, Sonne, Mond, Steine, Pflanzen und Tiere waren ihnen Eltern und Geschwister, denn alles gehörte für sie zum Kreis
des Lebendigen. Entsprechend ganzheitlich war ihre Heilkunde: eine Mischung aus Kräuter-und spiritueller
Medizin.
Die Indianer haben sich immer als Teil der Natur betrachtet:
Erde, Sonne, Mond, Steine, Pflanzen und Tiere waren ihnen Eltern und Geschwister, denn alles gehörte für sie zum Kreis
des Lebendigen. Entsprechend ganzheitlich war ihre Heilkunde: eine Mischung aus Kräuter-und spiritueller
Medizin.
Das indianische Heilwissen ging grundsätzlich davon aus, daß die Ursache jeder Krankheit in
einer gestörten Beziehung des Menschen zu den magischen Kräften lag. So sollten die Heilzeremonien die Geister dazu
bewegen, den Menschen Gutes zu tun, Gesundheit zu schenken und das Böse zu bannen. So effektiv die Heilkräuter der
indianischen Medizin unter pharmakologischen Gesichtspunkten auch sein mögen, sie wurden bei ernsthaften Leiden vor
allem als Begleitung zu den magischen Heilritualen gesehen. Vielleicht liegt speziell in dieser Kombination
aus praktischer Heilkunde und magischem Heilwissen die besondere Qualität und Stärke der indianischen
Medizin. Denn es ist unbestritten und von der medizinischen Forschung belegt, daß Medizinmänner selbst schwere
Krankheitsfälle lindern und heilen konnten. Einem Kranken sangen die Indianer ein heiliges Lied, das alle Dinge für so
vollkommen erklärt, als ob sie soeben erschaffen worden wären. Dadurch wurde der oder die Leidende mental in einen
Zustand der Vollkommenheit versetzt, der ihm oder ihr ermöglichte, seine oder ihre ursprüngliche Ganzheitlichkeit oder
Harmonie wiederzuerlangen.
Mit dem magischen Heilwissen geht auch eine gänzlich andere Interpretation der Entstehung von Krankheiten einher. Da ist nicht von Viren und Bakterien die Rede, sondern vom Büffel-Tabu und von Adler-Ansteckungen, vom bösen Blick der Eidechse und vom Bären-Traum.
In der Glaubenswelt der Indianer spielte der Adler eine dominierende Rolle; man schrieb seiner magischen Kraft die Beeinflussung von Gesundheit und Krankheit zu. Vor allem, wenn dem Vogel nicht die nötige Ehre erwiesen wurde, waren fatale Folgen für die Gesundheit und das Wohl des Stammes zu erwarten. Um dies zu verhindern, wurde mehrmals im Jahr der Adlertanz aufgeführt. Allerdings durfte das nur im Winter geschehen, was mit der tödlichen Feindschaft zwischen Klapperschlange und Adler zu tun hatte. Denn nur während ihres Winterschlafs war sichergestellt, daß die Schlangen die Tänze verschliefen und die Gesänge nicht hören konnten. Denn das wiederum wäre eine Beleidigung für die Klapperschlangen gewesen, und die gereizten Tiere hätten ihrerseits Unglück und Krankheit über den Stamm gebracht.
Neben solchen Tabu-Handlungen gab es auch Tabu-Orte: Stellen, an denen der Blitz eingeschlagen hatte, waren ebenso zu meiden wie Orte, an denen jemand auf unnatürliche Weise zu Tode gekommen war. Brach man das Tabu, konnte es passieren, daß einen selbst der Blitz traf oder daß man selbst auf unnatürliche Weise umkam, weil man den Zorn der gekränkten Geister auf sich lud. Ihre Vergeltung war dann Unglück und Krankheit.
Auch Fehler bei der Durchführung von Ritualen konnten mit Krankheit bestraft werden: Wenn ein Seher
den Inhalt seiner Vision erzählte, bevor diese abgeschlossen war, oder wenn ein Tänzer während der acht Tage dauernden
Sonnentanz-Zeremonie aß oder trank, obwohl das Fasten fester Bestandteil des Rituals war, konnten Unglück und
Krankheit die Strafe sein.
In diesem Sinn war jeder Mensch durch ein Fehlverhalten an seinen Krankheiten selbst
schuld. Allein die Tatsache, daß es überhaupt Krankheiten gab, ging auf Weisung magischer Urwesen
lange vor der Zeit der Ahnen zurück.
Leiden, die durch solch falsches Verhalten gegenüber Tieren und Orten sowie durch Entweihung von Ritualen und Ritualgegenständen hervorgerufen wurden, rechneten die Medizinmänner zu den “bleibenden Krankheiten”. Sie blieben als Bestrafung lange beim Bestraften. Anders verhielt es sich dagegen mit den “wandernden Krankheiten”. Sie wurden durch Unreinheiten verursacht und durchzogen den Körper. Sie waren vorübergehender Natur und bedurften nur der Heilkraft der Kräuter.
Außer Magie und Tabu-Bruch galten Träume, zumal wenn ihr Inhalt bedrohlich war, als Ursachen für Krankheiten. Oft bewirkten Traumbilder sogar bei einem anderen eine Krankheit. Wann ein Traum als unheilvoll zu gelten hatte, entschied der Medizinmann, dem Traumdeutung oblag. Der Medizinmann hatte zudem die Aufgabe, durch bestimmte Rituale und die Gabe magisch-starker Medizin die im Traum visualisierte Bedrohung durch Krankheit bereits vor ihrem Auftreten abzuwehren.
Vor unheilbringenden oder krankmachenden Energien von Träumen schützten sich die Indianer mittels magischer “Dreamcatchers”. Der Dreamcatcher war ein etwa handteller-großer, lederumwickelter Reif, in den einem Spinnennetz gleich in kunstvollem Muster Tierdärme eingespannt waren. Mit eingeflochten wurden magische Gegenstände, wie Perlen, Kristalle, Muscheln, Tierzähne, Dachs-, Büffel- oder Bärenhaare. Dreamcatchers wurden links und rechts der Schläfen oder auf der Brust getragen. Nach altem Wissen sollten die bösen Träume in dem Geflecht hängen bleiben und von der aufgehenden Sonne fortgenommen werden. Gute Träume dagegen wurden von den eingeflochtenen magischen Gegenständen erkannt und konnten durch die Nutzfalle hindurchschlüpfen.
MEDIZINMÄNNER
 Medizinmänner besaßen eine von der Geisterwelt an sie übertragene
Legitimation in Form magischer Beschwörungsrituale. Sie suchten die Unterstützung der Geistwesen zur
Diagnose vor und während der Heilrituale. Entsprechend war der Bedeutungsinhalt von “Medizin” ein anderer als in
unserem Sprachgebrauch, wo “Medizin” Arznei meint. Der Indianer sprach deshalb nicht von Medizinmännern oder
Medizinfrauen, sondern vom “Mann, der geheime Kraft hat” oder von der “Frau, die Geheimnisse
weiß”. Die Medizinmänner und Medizinfrauen heilten wie die Kräuterkundigen mit Pflanzensäften, Tees,
Breiauflagen und Schwitzbädern, Aussaugen, aber auch mit magischen Ritualen. Auf das Warum und Wieso der rituellen
Techniken antwortete ein Medizinmann:
Medizinmänner besaßen eine von der Geisterwelt an sie übertragene
Legitimation in Form magischer Beschwörungsrituale. Sie suchten die Unterstützung der Geistwesen zur
Diagnose vor und während der Heilrituale. Entsprechend war der Bedeutungsinhalt von “Medizin” ein anderer als in
unserem Sprachgebrauch, wo “Medizin” Arznei meint. Der Indianer sprach deshalb nicht von Medizinmännern oder
Medizinfrauen, sondern vom “Mann, der geheime Kraft hat” oder von der “Frau, die Geheimnisse
weiß”. Die Medizinmänner und Medizinfrauen heilten wie die Kräuterkundigen mit Pflanzensäften, Tees,
Breiauflagen und Schwitzbädern, Aussaugen, aber auch mit magischen Ritualen. Auf das Warum und Wieso der rituellen
Techniken antwortete ein Medizinmann:
“Ihr Weißen fragt immer nach dem Warum und Wieso
Damit erreicht man zwar Wissen, aber niemals Weisheit
Denn
wer so fragt, wird die Weisheit Zerstören
Wir fragen nicht, wir wissen einfach, daß es so ist,
weil es so
ist”
Medizinmänner hatten Kontakt zu einem oder sogar mehreren besonders mächtigen Schutzgeistern, mit deren Hilfe sie nicht rational erklärbare Taten vollbringen konnten. Im Gegensatz zu Kräuterheilern konnten Medizinmänner diese Geister herbeirufen, und sie konnten in Trance den eigenen Körper verlassen. Sie vermochten sich als Geistwesen an weit entfernten Orten aufzuhalten und in den Körper anderer Menschen einzudringen, um dort Krankheiten zu diagnostizieren und zu heilen.
Bekannt ist die Zeremonie des bebenden Zelts: der Medizinmann betrat, praktisch nackt, das Zelt, um eine Beschwörung vorzunehmen. Er murmelte Gesänge und schüttelte die Rassel. Man fesselte ihn mit starken Lederriemen. Er rief die Geister an. Während vor dem Zelt die Dorfgemeinschaft rhythmische Gesänge zum dumpfen Tamtam der Trommeln anstimmte, traf Mikenak, der Schildkrötengeist, ein. Dann hörte man das Knirschen von Schneeschuhen, dumpfe Axtschläge, das leise Klatschen eines Kanu-Paddels. Während all dieser Ereignisse schwankte das Zelt. Der Medizinmann sprach mit dem obersten Hilfsgeist und erhielt Prophezeiungen über zukünftige Ereignisse, über Krankheiten, ihre magischen Ursa chen, ihren Verlauf und ihre Heilungsmöglichkeiten. Der Medizinmann erfuhr weiter, daß böser Zauber die Ursache für die Erkrankung seines Patienten war. Jetzt wurde der Geist des hexenden Verursachers in das Zelt des Medizinmannes gerufen, wobei dieses von neuem zu beben begann. Erst als dieser versprach, den Krankheitszauber zurückzunehmen, wurde er von den Hilfsgeistern des Medizinmannes freigelassen. Dann stand das Zelt wieder still, und der von der Zeremonie völlig geschwächte und erschöpfte, auf unerklärliche Weise von seinen Fesseln befreite Medizinmann kroch aus dem Geisterzelt heraus. Das Ritual war damit beendet, und dem Kranken ging es bald besser.
Obwohl eher selten, konnte auch eine Frau in einer Vision zur Medizinfrau berufen werden. Viel häufiger waren die sogenannten “Gegenteilmänner”. Vom Geschlecht her eindeutig männlich, trugen sie Frauenkleider, gingen Frauenbeschäftigungen nach und sprachen mit hoher Fistelstimme. Solch ein “Gegenteilmann” konnte oft ein besonders mächtiger Medizinmann werden, weil er in einer Person sowohl männliche als auch weibliche Kräfte vereinte. Obwohl die Medizinmänner vor ihrer Geburt unter den Donnermächten gewohnt haben und über alles unterrichtet gewesen sein sollen, was sie auf Erden erwartete, muß man nüchtern feststellen, daß sie zur Zeit ihres Eintritts in das irdische Leben keine außergewöhnlichen Kräfte besaßen. Wie alle anderen Sterblichen mußten sie die Tortur der Visionssuche durchlaufen und auf diese Weise Macht anhäufen.
Das tiefe Wissen, zum Medizinmann berufen zu sein, bezogen die Indianer aus Visionen und Träumen, in denen Tiererscheinungen sie anwiesen, den Weg als Heiler zu gehen. Doch bedurfte es nicht immer einer Berufung im Traum oder während einer Vision, um Medizinmann zu werden. Es genügte auch, wenn man selbst mit Hilfe eines Eingeweihten eine schwere Krankheit überstanden hatte. Denn durch die Erfahrung am eigenen Leib lernte man die Heilriten und Heilkräuter kennen. Allerdings bedurfte es einer Ausbildung, und der Medizinmann konnte diese mit der Begründung ablehnen, die Weitergabe des heiligen Heilwissens würde seine magische Kraft schwächen oder gar aufheben.
Die wichtigsten Symbole der Medizinmänner waren der Otter und die Schildkröte. In eines dieser beiden Totems hineingeboren zu werden, bedeutete aber nicht, daß man Medizinmann wurde. Das Heilen war also nicht Personen von besonderer Geburt vorbehalten; es war eine besondere Gabe. Weil die Fähigkeit, heilen zu können, eine so einzigartige und besondere Gabe war, die nicht allein auf der Kenntnis der Pflanzen und ihrer Heilkraft beruhte, sondern auf der Heilkraft der Person, suchten die Medizinmänner Schüler, bei denen sie diese Fähigkeit vermuteten. Wer ausgewählt wurde, durchlief eine lange Lehrzeit. Zweck dieser Schulung war es, die persönlichen Heilkräfte zu entwickeln und zu erweitern und medizinische Kenntnisse zu erlangen.
Medizinmänner waren Philosophen. Sie befaßten sich nicht nur mit der Erhaltung des Lebens und dem Lindern von Schmerzen. Sie boten auch Hilfen und Lehren für das richtige Leben an, dessen Ziel das Wohl der Gemeinschaft war. Sie ergründeten die Zusammenhänge des Lebens und brachten dadurch ein neues Element in die Medizin:
Daß der Zustand des Körpers in direkter Beziehung zum Zustand des inneren Seins eines Menschen steht. Krankheiten, zumindest bestimmte Formen, wurden als körperlicher Ausdruck innerer Unordnung aufgefaßt. Demnach zielten alle magischen Heilhandlungen darauf ab, innere Unordnung in Ordnung und Harmonie zurückzuführen.
Ein wichtiger Bestandteil dieser Zeremonien war deshalb zuerst das rituelle Reinigen des Kranken mit Tabak und heiligem Zedernholz-Rauch. Mit Räuchern sollte aber auch vor Einflüssen böser Hexerei während der Zeremonie geschützt werden. Mit dem Rauch wurde verhindert, daß magischer Zauber zum Kranken vordringen und die Heilkraft der Kräuter und der Heilgebete schwächen konnte. Wurde das Weiterwandern der Krankheit befürchtet (wir würden von Ansteckungsgefahr sprechen), wurde zusätzlich Salbei ins Feuer geworfen. Von beiden Pflanzen, soviel als pharmakologische Ergänzung, sind antiseptische Inhaltsstoffe bekannt.
Für die Indianer dagegen hatten sie eine ganz andere, nämlich bändigende und abwehrende Kraft gegen bösen Zauber. Dann folgten die Reinigungsrituale mit der Federschwinge. Dabei strich der Medizinmann mit einem Fächer aus Adlerfedern mehrfach ganz nah über den Körper des Kranken hinweg, um so die Krankheit wegzuwischen. Nach indianischer Auffassung wurde die Krankheit damit an einen sicheren Ort verbannt: in die Haut einer Schlange, die diese bald abstreifte, oder in die Geweihspitzen eines Hirsches, das dieser bald abwarf.
Eine weitere rituelle Einrichtung des symbolisch-magischen Heilens war “Das Haus der heißen Steine”,
eine Schwitzhütte. “Das Haus der heißen Steine” diente der Therapie von Krankheiten sowie der
rituellen Reinigung. Außerdem war der Besuch im “Haus der heißen Steine” fester Bestandteil bei den Vorbereitungen zu
jeder religiösen Zeremonie oder vor einer Visionssuche. Die Schwitzhütte war eine kuppelförmige Konstruktion von
knapper Manneshöhe. Sie war aus biegsamen, im Kreis in den Boden gerammten und einander zugebogenen Weidenruten
aufgebaut. Darüber hingen Felle, so daß in der Hütte Dunkelheit herrschte. Eine Mulde in der Mitte wurde mit von außen
gereichten, im Feuer erhitzten Steinen aufgefüllt. Über sie goß man von Zeit zu Zeit Wasser, und es wurden Heilkräuter
verräuchert. Zur Schwitzhütten-Zeremonie wurde man vom Medizinmann eingeladen. Der achtete darauf, daß jeweils eine
gleiche Anzahl von Frauen und Männern als Zeichen der harmonischen Dualität des Kosmos teilnahm. Alle Teilnehmer
mußten nackt sein.
Der Aufbau der Schwitzhütte und der Ablauf der Zeremonien war stark symbolisch:
die die Fellkuppel tragenden Weidenzweige markierten die vier Weltviertel, die Mulde in der Mitte, also der Platz der
heißen Steine, symbolisierte das Zentrum des Kosmos. Dieser Bedeutungsebene war noch eine zweite zugeordnet: die
Schwitzhütte symbolisierte auch den Mutterleib. Man ging dorthin, um zu beten, zu meditieren und um
neu geboren zu werden. Dieses Neu-geboren-werden hing eng mit der therapeutischen Wirkung der Schwitzhütte zusammen.
Denn die Teilnehmer mußten sich auch “seelisch” nackt zeigen, das heißt, sie mußten auch ihre schlechten Gedanken
offenbaren.
Die Indianer nannten die Heilpflanzen “unsere grünen Schwestern”. In jeder “grünen Schwester” wohnte Manitu, die omnipotente Geistkraft. Die Pflanzen waren dem Menschen wohlgesonnen. Sie gaben ihm ihre heilende Kraft zur Behandlung der Krankheiten, und wenn ein Heiler nicht wußte, welche Arznei die richtige war, so erfuhr er es vom Geist der Pflanze. Wenn der Medizinmann eine Pflanze oder ein Kraut pflückte, dann sprach er damit. Er sagte dann, daß er es nicht ohne Grund abpflückte, sondern weil er der Hilfe bei der Heilung eines kranken Menschen bedarf. Für die “Götterblume”, eine in den Bergen wachsende Primelart, war erforderlich, daß der kräutersammelnde Medizinmann eine ganze Nacht neben der Pflanze schlief und meditierte, bevor er sie kurz vor Sonnenaufgang erntete. Nachdem der Patient den Tee getrunken hatte, wurde die Pflanze in der Erde vergraben, und es wurde ihr gedankt.
Die Heilmittel und Arzneien standen in ihrer Wirksamkeit jener der westlichen Erfahrungsmedizin in nichts nach. Aus Weiden gewinnt man Salizylsäure, den Rohstoff für Aspirin. Die Indianer benutzten gekochte Weidenrinden und -wurzeln gegen Kopfschmerzen und um Fieber zu senken. Indianerfrauen kauten Steinbrech zur Empfängnisverhütung. Heute haben Chemiker aus dieser Pflanze eine östrogen-artige Substanz isoliert, wie sie bei der Pille verwendet wird. Aus der Brechwurz, die die Indianer als Magen-Medikament nutzten, wird Emetin, ein Brechmittel bei Magenvergiftungen gewonnen. Und Rauwolfia-Wurzel, von den Indianern zur Beruhigung gekaut, enthält Reserpin, eine nervenberuhigende Substanz, die in der Psychiatrie eingesetzt wird.
Verglichen mit der traditionellen europäischen Kräuterkunde waren die indianischen Anwendungen
differenzierter und vielfältiger. Die Indianer kannten verschiedene Methoden, um die Kräfte eines
Heilkrauts zu nutzen: Sie kochten den Stengel zu Tee, stampften die Blätter zu Brei und rauchten die Blüten.
Doch
ihr Heilwissen reichte noch viel weiter. So wurden manche Kräuter nur zu bestimmten Tages- oder Nachtzeiten geerntet,
Rinde, die man zu einem Heilbrei zerstampfte, nur von der Nordseite eines Baumes genommen, ein spezielles Kraut nur
gepflückt, wenn es durch einen besonders bizarren Wuchs auffiel. Eine Pflanze durfte nur in Vollmondnächten, eine
andere nur dann gepflückt werden, wenn sich keine Schlange in ihrer Nähe aufhielt. Der Gebrauch halluzinativer
Pflanzen wie Bilsenkraut, Stechapfel und Peyote-Kaktus verhalf den Medizinmännern zu ihrer visionären Kraft, mit der
sie in den Körper des Patienten sahen und seine Krankheit erkennen konnten. Bei psychischen Leiden und zur
Schmerztherapie wurden sie dem Patienten als Heilmittel verabreicht. Auch hier bestätigte die moderne Biochemie und
Psychiatrie die Heilwirkung.
Grundsätzlich war die indianische Heilkunde vorbeugend. Viele Heilpflanzen wurden regelmäßig als Gemüse gegessen. Kräftige Tees aus Blättern, Wurzeln und Rinden waren Bestandteile der indianischen Kost. Bei notwendigen Behandlungen nahmen sie ihre Medizin meist in dieser Form zu sich. Außerdem waren Breiauflagen und Pflaster aus Pflanzen verbreitet. Große Blätter legte man einfach auf die betroffenen Stellen, Rinden und kleinere Kräuter band man zerhackt oder zerquetscht mit einem Deckblatt oder mit einem Lederflicken fest.
“Wenn es keinen Tod gibt, nur den Wechsel in andere Welten
Was ist dann das Leben?
Es ist das Aufflammen
eines Leuchtkäfers in der Nacht
Es ist der Atem des Bisons im Winter
Es ist der kleine Schatten im Gras, der
sich bei Sonnenuntergang verliert
Doch die Stille ist das vollkommene Gleichgewicht des
Körpers, des Geistes
und der Seele”
 Klaus Bauer
Klaus Bauer

