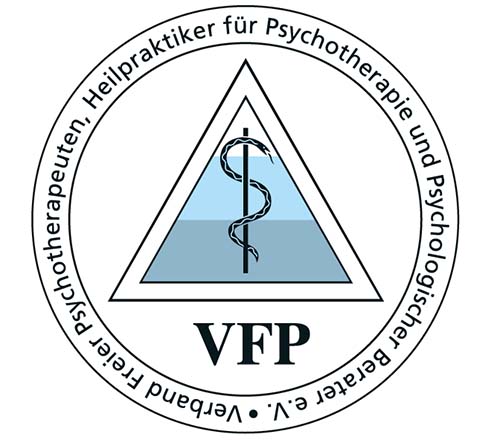 Tipps vom Profi:
die Zielgruppe eng fassen
Tipps vom Profi:
die Zielgruppe eng fassen
Der Bedarf an Coaches und Beratern ist ungebrochen groß. Gleichzeitig tun sich aber viele schwer damit, neue Klienten zu gewinnen. In mehreren Büchern gibt Bernhard Kuntz, Inhaber einer PR- und Marketing-Agentur, Tipps, die einleuchten.
Grundsätzlich, so Kuntz, stünden Berater, Rechtsanwälte, Ärzte und Therapeuten vor dem gleichen Problem: Man kann ihr Angebot nicht anfassen. Anders als bei einem Haus oder Auto ist es schwierig, die angebotene Leistung objektiv zu vergleichen. Der Experte rät deshalb, das Beratungsangebot so weit wie möglich zu materialisieren, z.B. durch den Einsatz von Checklisten und Seminarunterlagen. Hilfreich sei auch, sich als Spezialist zu präsentieren und nicht als Alleskönner. Bei einem klar definierten Kundenkreis sei es sinnvoll, beispielhaft darzulegen, wie einem Klienten in vergleichbarer Lage geholfen worden ist.
Gerade die Spezialisierung ist nach den Erfahrungen von Kuntz wichtig, doch genau vor diesem Schritt schrecken viele zurück – aus Angst, Kunden zu verlieren, die sie ja ohnehin noch nicht haben. Entsprechend verwaschen seien die Profile vieler Mitglieder der o.g. Berufsgruppen. Damit höben sie sich eben nicht von der Masse der Mitbewerber ab. Vielmehr sollte jeder Anbieter seinen eigenen speziellen Markt (er)finden, rät der Experte. Damit könne sich jener von seinen Mitbewerbern absetzen. Wie jemand seinen potenziellen Kundenkreis definiert, bleibe dabei jedem selbst überlassen.
Wichtig sei dann, die eigenen Kompetenzen mit Blick auf die Zielgruppe herauszuarbeiten und das Marketing passgenau abzustimmen. Das gilt auch für Psychologische Berater oder Coaches: Besser eine kleinere, klar umrissene Zielgruppe, der gegenüber man sich glaubhaft als Profi präsentiert, als ein zu weit gefasstes Alleskönner-Portfolio, bei dem der einzelne Klient sich mit seinem speziellen Anliegen nicht angesprochen fühlt.
Angeschlagene Psyche erhöht das Risiko für Long-COVID
Etwa 20% aller Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, leiden noch 6 Monate nach der Erkrankung unter körperlichen Beschwerden. Woran das liegt, ist noch nicht klar. Erwiesen ist jedoch, dass die Psyche eine große Rolle spielt: Depressive Symptome, Angst, Stress und Einsamkeit erhöhen das Risiko für Long-COVID um bis zu 50%.
Die aktuellen Erkenntnisse waren Thema beim Deutschen Kongress für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Berlin Anfang Mai. Long-COVID ist gemäß S1-Leitlinie definiert als das Anhalten von Symptomen nach einer COVID-19-Infektion über die Dauer von 4 Wochen. Nach einem Zeitraum von 12 Wochen spricht man von einem Post-COVID-Syndrom. „Bei Vorhandensein von zwei der genannten Faktoren war das Risiko für Long-COVID um bis zu 50% erhöht“, berichtet Dr. Christine Allwang, Leitende Oberärztin an der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum rechts der Isar der TU München. Es kristallisiere sich heraus, dass ein erheblicher Anteil der Long-COVID-Betroffenen eine Vorbelastung, wie z.B. eine Depression oder Angststörung, aufwiesen.
Suizidprävention bei Männern
Im Jahr 2019 starben in Deutschland 9041 Personen durch einen Suizid, das sind mehr als 25 Personen pro Tag. Dabei sind 76% der Opfer Männer; v.a. ab dem 55. Lebensjahr zeigen diese besonders hohe und über das Alter stetig steigende Suizidraten. Man spricht hier von einer „stillen Epidemie“. Dieser widmet sich der Forschungsverbund „Suizidprävention für Männer“.
Das von den Universitäten Leipzig und Bielefeld in Kooperation mit der Medical School Berlin entwickelte Programm richtet sich einerseits an Männer, die eine Selbsttötung in Erwägung ziehen, andererseits an Angehörige. „Was sind Warnzeichen für und Wege aus einer Krise?“ und „Welche Hilfen sind wann und wie erreichbar?“ sind zentrale Themen des Angebots. Videos mit Schilderungen von betroffenen Männern und Experten sollen Perspektiven aus scheinbar ausweglosen Situationen schaffen und das Thema entstigmatisieren.
Ein Teilprojekt unter Federführung der Medical School Berlin zielt außerdem speziell auf „Gatekeeper“ ab, also Personen, die mit suizidgefährdeten Männern in Kontakt stehen oder standen und so helfend eingreifen könnten. Mit der Forschungsarbeit soll herausgefunden werden, welche Personengruppen als „Gatekeeper“ in Frage kommen und welche Belastungsfaktoren sich bei Suizidenten im Vorfeld der Selbsttötung identifizieren lassen. Auf dieser Basis soll ein E-Learning-Programm zur niedrigschwelligen Suizidprävention von „Gatekeepern“ entwickelt werden.
 Dr. paed. Werner
Weishaupt
Dr. paed. Werner
Weishaupt
Heilpraktiker für Psychotherapie, Dozent für Kinesiologie und Psychotherapie, Präsident des
VFP e.V., Autor
dr.weishaupt@vfp.de

